
Das Vernichtungslager Gakowa
Dorthin wurden zwischen dem 13.3. und dem 17.10.1945 die nicht arbeitsfähigen Personen deutscher Volkszugehörigkeit, Ältere und Kranke sowie Mütter mit Kleinkinder bis zu 2 Jahren gebracht. In Gakowa wurden hautsächlich die Deutschen aus der West-Batschka, für die Bezirke Sombor, Apatin und Hodschag interniert.
Ursprüngliche Einwohnerschaft von Gakowa : 2.700 Personen
Durchschnittliche Anzahl der Lagerinsassen: 17.000 Personen
Bestandsdauer des Lagers: 12.3.1945 bis Januar 1948
Todesfälle: mindestens 8.500 Personen davon sind 5.827 Personen namentlich erfaßt. ( Aus der Gemeinde Filipowa sind von den hier ca. 3.100 Internierten Filipowaern 762 Personen verstorben)
Hauptsächliche Todesursache: Unterernährung, Typhus, Ruhr, Malaria.
Die Häuser waren sieben fach überbelegt. Bereits in den ersten zehn Monaten starben ca. 4500 Personen. In den Häusern lagen die Insassen auf einer dünnen Strohschütte am Boden dicht nebeneinander und füllten die Zimmer, Küchen, Kammern und selbst die leer stehenden Kuh-und Pferdeställe. Donauschwäbische Männer , wurden, zwölf an der Zahl, zu „Gassenkommandanten“ bestimmt. Sie hatten die Befehle der Lagerkommandatur weiterzugeben und vor allem die in ihren Gassen täglich anfallenden Totenzahlen der Kommandantur zu melden.
Quelle: Verbrechen an den Deutschen in Jugoslawien 1944 – 1945, Arbeitskreis Dokumentation der Donauschwäb. Kulturstiftung, München 2000, ISSN 0172-5165-67
Robert Zollitsch, emerierter Erzbischof von ‚Freiburg ermahnt, die Erinnerung wach zu halten.
„Kaum eine andere deutsche Volksgruppe hatte unter dem Zweiten Weltkrieg und seinen furchtbaren Folgen so sehr zu leiden wie die Donauschwaben aus Jugoslawien, Rumänien und Ungarn. Ihre Geschichte ist in den Jahren 1944 – 1949 zur Passionsgeschichte, zur unvorstellbaren Leidensgeschichte geworden. Ihrer Opfer zu gedenken und die Erinnerung wach zu halten, ist und bleibt Auftrag der Überlebenden und der nachfolgenden Generation. Wer all die menschlichen Schicksale, das vielfältige Leid, die unfassbaren Geschehnisse um unsere Landsleute verdrängt, der macht sie ein weiteres Mal zu Opfern, zu Opfern des Vergessens. (…) Der Opfer der donauschwäbischen Passion und Ihrer Leiden zu gedenken, heißt nachzufragen und sich Gedanken zu machen – Gedanken gegen das Vergassen so vieler Opfer und der von ihnen erlittenen Grausamkeiten. Wir wissen uns verbunden mit unseren Landsleuten, die unschuldig und auf grausame Art und Weise zu Opfern skrupelloser Machtinteressen, eines menschenverachtenden Nationalismus und einer menschenvernichtenden Politik wurden.“
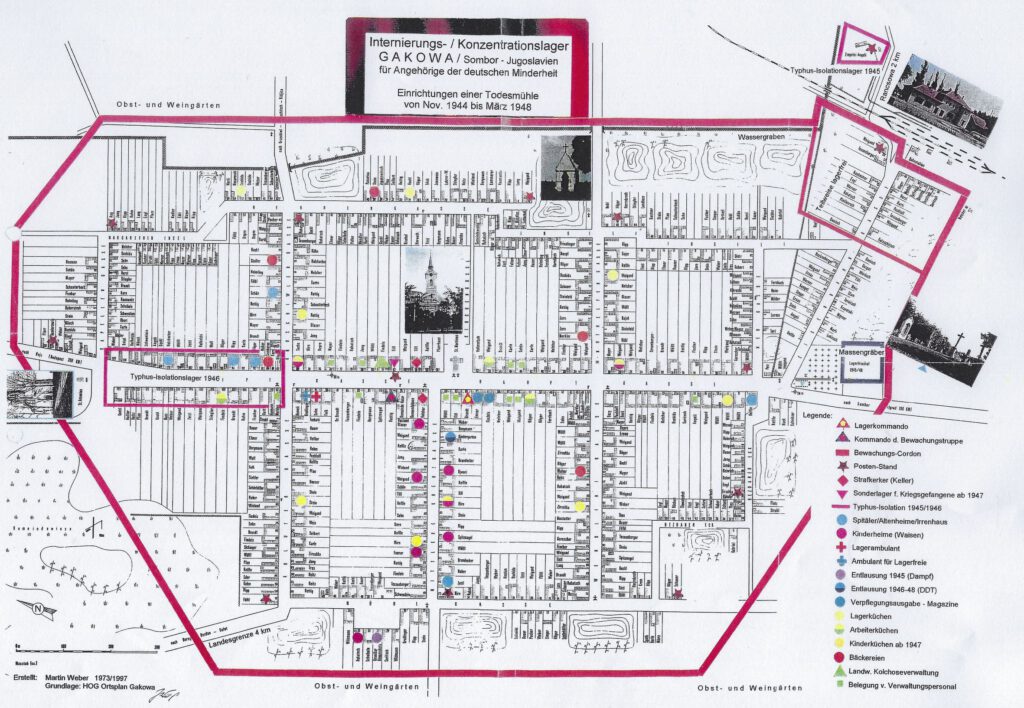
Zeitzeugenberichte aus dem Lager Gakowa
Aus dem Tagebuch des Pfarrers Mathias Johler Mathias Johler wurde am 22.2.1913 in Filipowa geboren. Er wurde am 29. 6.1937 zum Priester geweiht. Johler war freiwilliger Lagerseelsorger. Er hat ein aufschlußreiches Tagebuch hinterlassen, ohne literarischen Anspruch , aber zweifellos mit der Absicht, die Außenwelt in gläubig-nüchterner Zeugenschaft über himmelscreiendes Unrecht zu unterrichten.
Die letzten Tagebucheintragungen, bevor er selbst am 10. Dezember 1945 an Typhus erkrankte und nach vier Wochen schweren Fiebers und zeitweiliger Bewusstlosigkeit überlebte, lesen sich wie eine Sequenz des Todes:
19.11.1945: Heute beerdige ich den 1945sten hier im Lager. Die Zahl erinnert an die Jahreszahl unseres Heils.
25.11.1945: Die Krankenzahl steigt von Tag zu Tag. Nach einer Schätzung des Arztes liegen nun 2000 Kranke und Gebrechliche welche der Pflege bedürfen. Es ist keine Seltenheit, dass man in Häuser kommt mit zehn bis 12 Kranken in einem Zimmer. Dazu wütet der Typhus unbarmherzig. Der LagerApotheker ist gestorben und der Arzt liegt auch schwer krank.
1.12.1945: Nun hat der Herr auch aus der Mitte meiner Angehörigen ein Opfer angenommen: Die Schwägerin ist tot. Heute soll sie beerdigt werden. In Gedanken versunken über das Schicksal unserer Familie und über das der kleinen Waisen Evi und Eugen ging ich zum Friedhof, um zu sehen, ob das Grab schon fertig sei. Wie ich eintrete, sehe ich zwei Mädchen stehend, frierend, zitternd und bitterlich weinend. -Ein gutes Wort und ich erfahre dass die Kinder ihre Mutter suchen. Sie erzählen mir, dass ein Wagen beim Hause vorgefahren sei und die Mutter aufgeladen habe. Arme Kinder, ich weiß nun alles; es war der Totenwagen. „Jetzt sind wir ganz allein, klagt das ältere elfjährige Mädchen, nur noch ein Brüderchen mit vier Jahren liegt daheim krank. Und wen trägst Du im Arm? „Das ist mein Brüderchen, zehn Monate alt, sagte sie und drückte es, in ein Tuch gehüllt, an ihre schluchzende, zitternde Brust; doch vergebens, das Kind war tot. Erlkönig von Goethe? Nein, ein Lagerkinderschicksal.
3.12.1945: Schon längere Zeit ist es den Tischlern verboten, Särge für verstorbene Lagerleute zu zimmern. Nun dürfen auch keine Grabkreuze mehr gefertigt werden.
6.12.1945: In Sachen der Friedhofsarbeiter habe ich beim Intendant des Lagers interveniert. Um eine kleine Verbesserung der Kost habe ich angesucht. Als ich auf die täglich zunehmende Sterbeziffer hindeutete, bekam ich ein sarkastisches „Hvala Boga“ (Gott sei Dank) zurück.
9.12.1945: Gestern waren zehn Dekagramm Brot pro Person, heute gab es überhaupt kein Brot. Auch keine Suppe, nur einen Batzen Kukeruzschrot, ein wahres Schweinefutter. Dabei breitet sich Flecktyphus mit unheimlicher Schnelligkeit aus. Die Benennung“ Vernichtungslager“ wird allem Anschein nach realisiert. Soeben erfahre ich, dass unser Arzt Dr. Brandt, an Flecktyphus gestorben ist.
13.12.1945: Schon der vierte Tag weder Suppe noch Brot für etwa 12.000 bis 13.000 Menschen. Kinder sind heute bis zu meinem Krankenbett gekommen, Brot zu betteln. Und ich habe selbst nichts. Rein nichts zu geben.
Januar 1946: Heute sind es gerade vier Wochen, daß mich hohes Fieber ans Bett zwang. Einige Tage nachher erkrankte auch der hiesige Pfarrer Dobler. Er hatte Flecktyphus , ich an Bauchtyphus. Beide haben wir mit dem Tode gerungen. Ihn rief heute der Herr des Lebens und des Todes in die Ewigkeit. R.i.P.) Ich aber bin mit Gottes außergewöhnlicher Hilfe soweit, dass ich nun – wenn auch noch im Bett – diese Eintragung machen kann.
9.6.1946: Was man schon längere Zeit befürchtet, ist zur Wirklichkeit gewortden: Die Grabkreuze werden von den Gräbern gerissen und zum Brennholz geworfen. Die Grabhügel werden der Erde gleich gemacht. Wie bei Verbrechern. Wohl hat noch nichts so tief unsere Leute erschüttert wie diese Verordnung.
14.2.1946: Not leiden ist schwer. Nicht helfen können ist aber schwerer. Und nicht helfen dürfen am schwersten.Das weiß ich jetzt wo ich allem zusehen und zuhören muß, jedoch nicht mal den Sterbenden beistehen darf.
29.6.1946 Der erste Transport der eltenlosen Kinder wurde heute in aller Eile per Lastauto abtransportiert. Nichts durften die Kinder mitnehmen, keine Kleider, keine Andenken an die Eltern. Angeblich werden sie zur Erholung gebracht.
18.7.1946: Schon gestern wurde irgendwie bekannt, dass die Kinder aus den Kinderheimen – es handelt sich um 700 bis 800 Kinder – fortgeliefert würden. Heute morgen wurden tatsächlich circa 550 Kinder zur Bahnstation geführt. Niemand weiß wohin? Unheimlich verschwiegen ging alles zu. Die noch verbliebenen Kinder, die bis jetzt bei den Großeltern oder Verwandten untergebracht sind, müssen abgegeben werden, damit für sie eine bessere Zukunft besorgt werden kann. Zum Schmerz der betroffenen Angehörigen wurde noch dieser Hohn und Spott dazugefügt. Dabei wurde zugleich gedroht: „Wer die Kinder nicht bringt, wird erschossen“.
Quelle: Bild einer Donauschw. Gemeinde Bd. 6, Seite 144 – Filipowaer Heimatbrief Nr. 4/ 1964 Seite 8 ff/ Leidensweg der Donauschwaben / Donauschw. Kulturstiftung 1995 – Band 3, Seite 286 – 318/ Donauschwäb. Martyrologium Herausgeber Gerhardswerk Stuttgart 2016 Seite 270 -280.
Kaplan Mathias Johler berichtet weiter:
Die letzten Tagebucheintragungen, bevor er selbst am 10. Dezember 1945 an Typhus erkrankte und nach vier Wochen schweren Fiebers und zeitweiliger Bewusstlosigkeit überlebte, lesen sich wie eine Sequenz des Todes:
„25. November 1945. Schon einige Tage ungesunde, nasskalte Witterung. Die Krankenzahl steigt von Tag zu Tag. Nach einer Schätzung des Arztes liegen um die 2000 Kranke und Gebrechliche, die der Pflege bedürften. Es ist keine Seltenheit, dass man in Häuser kommt mit zehn bis zwölf Kranken in einem Zimmer. Der Typhus wütet unbarmherzig weiter. Der Lager-Apotheker ist gestorben, und der Arzt ist auch schwer krank …
1.Dezember 1945. Nun hat der Herr auch aus der Mitte meiner Angehörigen ein Opfer angenommen: Die Schwägerin ist tot. Heute soll sie beerdigt werden. In Gedanken versunken über das Schicksal unserer Familie und über das der kleinen Waisen Evi und Eugen ging ich zum Friedhof, um zu sehen, ob das Grab schon fertig sei. Wie ich jedoch eintrete, sehe ich vor dem weitgeöffneten Tor der Totenkammer zwei Mädchen stehen, frierend, zitternd und bitterlich weinend. Ein gutes Wort, und ich erfahre, dass die Kinder ihre Mutter suchen. Eine Frage, und sie erzählen mir, dass ein Wagen beim Hause vorgefahren sei und die Mutter aufgeladen habe. Arme Kinder, ich weiß nun alles; Es war der Totenwagen. ‚Jetzt sind wir ganz allein’, klagte das ältere, elfjährige Mädchen, nur noch ein Brüderchen mit vier Jahren liegt daheim krank. Und wen trägst denn du im Arm?’ frage ich. ‚Das ist auch mein Brüderchen, zehn Monate alt’, sagt sie und drückt es, in ein Tuch gehüllt, an die schluchzende, zitternde Brust; doch vergebens; das Kind war tot. Erlkönig von Goethe? Nein, ein Lagerkinderschicksal.“
6. Dez. 1945: In Sachen Friedhofsarbeiten habe ich beim Indentant des Lagers interveniert. Um eine kleine Verbesserung der Kost habe ich angesucht. Als ich auf die täglich ansteigende Sterbeziffer hindeutete bekam ich eine sarkastisches „Hvala Boga“ (Gott sei Dank) zurück.
9. Dezember 1945. Gestern waren es zehn Dekagramm (hundert Gramm, Red.) Brot pro Person, heute gab es überhaupt keines. Auch keine Suppe, nur einen Batzen Kukuruzschrot, ein wahres Schweinefutter, und der Flecktyphus verbreitet sich mit unheimlicher Schnelligkeit. – Die Bezeichnung Vernichtungslager wird der schrecklichen Wirklichkeit gerecht. Soeben erfahre ich, dass unser Arzt Dr. Brandt an Flecktyphus gestorben sei. Mir ist es auch bis jetzt noch nicht gelungen, eine Schutzimpfung zu bekommen.“
Quelle: Paul Mesli/Franz Schreiber/Georg Wildmann: Filipowa – Bild einer donauschwäb. Gemeinde, Bd. 6: Kriegs-und Lageropfer, Wien 1985, Seite 144

Zeitzeugin Magdalena Brenner (Mutter von sieben Töchtern) berichtet:
Die Mutter von sieben Töchtern schreibt über das Schicksal ihrer Familie; der Mann und zwei Schwiegersöhne waren beim Militär, die Deportation ihrer Tochter zur Zwangsarbeit nach Rußland, dann die Einbeziehung weiterer vier Töchter zur Zwangsarbeit in der Batschka Anfang 1945 und wie sie mit den zwei Jüngsten Töchtern Viktoria (12) und Katharina (9) sowie den beiden kleinen Enkelkindern am 31. März 1945 aus dem Haus getrieben und im Anschluß nach Gakowa transportiert wurde. In der Folge erzählt sie vom großen Sterben , das um Weihnachten 1945 einsetzte, wie sie selbst und die vier ihr anvertrauten Kinder von der ausgebrochenen Typhusepidemie nicht verschont blieb. Sie fährt fort:
„Am 14. Jänner 1946 überrumpelte uns ein großer Schneesturm. Wir waren nicht mehr so krank. Wir hatten nichts zu essen. Der Hunger war etwas furchtbares. In dieser stürmischen Nacht kam überraschend mein Mann mit einem Grenzführer von Gara/Ungarn ins Lager. Er fand uns nach 16 Monaten in diesem Zustand. Es war eine große Freude. Er wollte uns aus dem Lager heraus holen. Dann kam das Furchtbare. Im Lager wurde der Befehl ausgegeben, dass die Kranken umgesiedelt werden müssten.
Sie kamen in eine andere Gasse. Die Kinder und die Alten extra. Dies ausgerechnet in diesem furchtbaren Schneesturm, der über Gakowa tobte. Man konnte sich gewiss nichts Schlimmeres und Verhängnisvolleres erdenken, als Tausende Todkranke von ihrem Krankenlager aufzutreiben, in den Schneesturm zu treiben oder sie hinauszutragen, um sie umzusiedeln. Es gab keinen Ausweg. Man drohte jedem, der dem Befehl nicht nachkam und nachher erwischt werden sollte, mit der standrechtlieben Erschießung. Man musste aufstehen und gehen. Partisanen kamen in die Häuser, brüllten herum und trieben die Leute einfach auf die Straße. Es gab in der Zeit Tausende Kranke, die überhaupt nicht gehen konnten. Man lud sie auf Schubkarren und wanderte mit ihnen auf der Straße in dem großen Schneesturm herum, bis man endlich in einem Haus ein neues Plätzchen fand. Viele Kranke hatten niemanden mehr, der sie wegbringen konnte. So krabbelten diese in dem Schneetreiben wie kriechende Tiere herum. Viele starben an diesem Tage auf der Straße im Schneesturm. Das war ja auch von der Lagerleitung so ausgedacht, denn es sollten immer mehr Menschen von uns auf die Seite geschafft werden. Noch mehr starben in den folgenden Tagen. Die Kranken kamen in den neuen Zimmern auf kaltes Stroh. Wie sollte da eine Genesung möglich sein? Wer diesen Tag als Kranker überstanden hat, kann es wohl als ein Wunder betrachten. Auch mich betraf die Umsiedlung.
Und gerade in diesem schrecklichen Schneetreiben war mein Mann gekommen um uns mitzunehmen. Ich hatte 40 Grad Fieber und die kleine Elisabeth und Monika ebenso. Ein flüchten in diesem Zustand war nicht möglich. Er sah ein, dass wir alle zu schwach sind, er wollte nun zurück um später wieder zu kommen. Nur unsere Tochter Maria schloss sich ihrem Vater mit dem fünf jährigen Martin und Tochter Viktoria an. Es war für uns eine große Aufregung, alles an einem Tag, Ankunft des Mannes, die Umsiedlung der Kranken und der Fluchtversuch eines Teils der Familie. Es war ein Wagnis auf Leben und Tod. Am Abend des 16.1.1946 schlichen sich mein Mann, die Tochter Viktoria und Maria mit dem Kind aus dem Lager. Der Fluchtführer ein junger Mann aus einer Nachbargemeinde nahm auch seine Familie und Angehörige mit. Es war leicht bei diesem Schneesturm aus dem Lager zu kommen , aber der Weg …? Der Weg im tiefen Schnee war für die Schwachen kaum genesenen Lagerleute furchtbar schwer, sie irrten herum. Bald waren einige den Strapazen nicht mehr gewachsen. Zuerst die Schwiegermutter des Fluchtführers, dann seine Frau. Sie starben beide 1 km vor der ungar. Grenze auf freiem Feld im Schnee. Mein Mann versuchte nun allein mit seinen Töchtern weiter zu kommen, doch er fand nicht den richtigen Weg. So entschloss er allein den richtigen Weg zu suchen die Kinder sollten sich ausruhen. Als er zurück kam, ging es Maria nicht mehr gut. Da raffte sie mein Mann auf und führte sie zu einem Maislaubhaufen. Hier ca. 1 km vor der Grenze, suchten sie Zuflucht. Maria wurde immer Schwächer und kurz darauf starb sie in den Armen ihres Vaters im Maisstrohhaufen. Sie bestürmten den Himmel im Gebet. Mein Mann raffte sich auf um weiter nach dem Weg nach Ungarn zu suchen, Er wurde nun von einem Grenzposten gefangen. Er musse die tote Tochter zurücklassen. Mein Mann , Viktoria und der kleine Martin wurden nun nach Rigitza aufs Kommando getrieben. Dort wurden sie misshandelt und in den Keller gesperrt. Nach ein paar Tagen holte man sie wieder heraus zum Verhör. Der Kommandant diktierte: „Tod durch erschießen“. Sie wurden nun auf die Gasse vor der Kommandantur getrieben und mussten sich in den Schnee setzen. Ein Partisan riss dass Fenster auf und richtete das Gewehr auf sie. Im letzten Moment kam ein anderer Partisan und schob ihn weg und machte das Fenster wieder zu. Nachher trieb man sie in das Lager nach Kruschiwl. Der Weg war furchtbar, der viele Schnee, die Kälte und die Folterungen. Später fand die Familie über Gakowa wieder zusammen und konnte über die Grenze nach Ungarn flüchten.“
Quelle: Madalena Brenner, geb. Held *1894 -Filipowaer Heimatbrief 12/1969, Seie 24 ff und Leidensweg der Deutschen im komm. Jugodl.-Band 3-Donauschw. Kulturstiftung 1995 Seite 373 -376 – Bericht gekürzt.

Quelle: Paul Mesli/ Franz Schreiber/ Georg Wildmann – Bild einer Donauschw. Gemeinde, Bd. 6: Kriegs-und Lageropfer, Wien 1985, Seite 157
Quelle: Vorwort des Buches „Donauschwäbisches Martyrologium“ ISBN 978-3-86417-084-3
Der schreckliche Winter 1945-1946 im Lager Gakowa von Georq Offenbächer *1930 /Cleveland/Ohio
Es herrschte Winter im Todeslager Gakowa. Der Winter 1945-1946,war ein schrecklicher Winter, denn es gab kaum eine Möglichkeit zum Betteln zu gehen. Der Schnee lag tief und man konnte sich nirgends verstecken, da alle Blätter von den Bäumen abgefallen waren und eine kahle Landschaft hinterließen. Die Titopartisanen hatten das einst verträumte Dörfchen Gakowa in eine Hölle auf Erden verwandelt, wo wir zusehen mussten, wie der Eine und der Andere dahinsiechte. Hatten wir im Sommer die Möglichkeiten, uns aus dem Lager zu schleichen, um bei Bauern zu arbeiten und betteln zu gehen, so gab es jetzt nur eines: beten und hoffen, dass wir diese schweren Zeiten überleben.
Die‘ Bretterzäune und Dachbodenlatten waren schon längst für Brennholz aufgebraucht und es wurde täglich kälter. Nun waren wir froh, wenn wir ein paar Bohnen, eine Blättchen Kraut oder ein Stückehen Kartoffel in der Einbrennsuppe fanden. Es gab jetzt Kuhrüben. die zum größten Teilbereits angefault waren, und .hartes schimmeliges Maisbrot zum Essen. Das Brot war hart genug, um dem Tito ein Loch in den Kopf zu schlagen, so sagten die Leute.
Täglich starben nun mehr und mehr Menschen. In den Massengräbern häuften sich die Leichen. Auf dem Friedhof war kein Platz mehr für die Toten. Es wurde ein großes Massengrab hinter dem Friedhof gegraben, und als dieses voll war ein zweites, später ein drittes und noch mehr. Der Geruch der Toten in den Massengräbern wurde von Tag zu Tag stärker und stärker, bis der Geruch das ganze Dorf und die Gegend weit darüber hinaus erfasste. Einer der bekanntesten, grausamsten und dafür am meisten gefürchteten Lagerkommandanten war Grabic, auch Suco (Schutzo) genannt, ein aus Syrmien stammender Partisan, der seine Kommandantur im September 1945 antrat und uns zehn Monate lang schikanierte. Unter seiner barbarischen Leitung gelang es ihm, vielen unserer donauschwäbischen Landsleute großen Kummer, Leid und Schmerzen hinzuzufügen, bis sie nicht mehr konnten. Suco war derjenige, der die vielen sinnlosen Himjchtungen.anordnete. Eines Tages mussten wir Kinder vor der Kirche antreten, um dort mehrere Stunden zu warten, bis zwei Partisaninnen aus dem Gefängnis kamen und sechs oder sieben Gefangene herausbrachten. Sie stellten Leute vor der Kirche auf und schossen sie mit ihren Maschinenpistolen erbarmungslos nieder. Die Kinder mussten danach die Toten auf den Wagen laden und zum Friedhof fahren. Auch diese grausame Tat, die sicherlich als abschreckendes Beispiel dienen sollte, konnte den Strom der Bettler nicht aufhalten. Wir hatten nur die Wahl, stehlen oder betteln zu gehen, um eine Möglichkeit zum Überleben zu haben – mit dem Risiko, dabei gefangen und erschossen zu werden.
Auch Kindern blieb dieses Los erschossen zu werden nicht erspart. Als eines Tages 17 Kinder gefangen wurden, die vom Betteln nach Gakowa zurückkehrten, führte man sie am nächsten Tage zu den Massengräbern und ließ sie erbarmungslos erschießen. Das älteste der Kinder war 14 Jahre alt und das jüngste Kind war ein vier Jahre altes Mädchen, welches von ihrer Schwester zum Betteln mitgenommen worden war“. Nach diesem Vorfall versuchten die Partisanen eine neue Methode. Jedesmal wenn ein Kind jetzt gefangen wurde, zwangen sie dieses Kind den Partisanen zu sagen, wer und wo seine Angehörigen sind. Auf diese Weise wurden jetzt die Angehörigen der Kinder bestraft. Mein Bruder Jakob, der heute im State New York wohnt, war damals gerade 10 Jahre alt, als er von den Partisanen erwischt wurde. Man versuchte ihn zu zwingen, den Namen seiner Mutter zu nennen. Er jedoch verweigerte dies zu tun, und wurde daraufhin an den Beinen festgebunden und in einen Brunnen hinunter gelassen, bis sein Kopf unter dem Wasser war. Man zog ihn dann wieder hoch. Aber immer wieder verweigerte er es den Namen seiner Mutter preiszugeben. Erst als er dem Tode nahe war, ließ man ihn laufen. Heute noch leidet Jakob gesundheitlich von diesem Vorfall.
Quelle: Martyrologium der Donauschwaben/Herausgeber Gerhardswerk Stuttgart 2016 Seite 127/ Filipowaer Heimatbrief 66/ 2003 Seite 105/6 und Hans Kopp -The History oft the Danube Swabians in word and pictures -The last generation forgotten – die Nachkriegserinnerungen eines Kindes, Cleveland, Ohio, 1999, S.122-140
Kindheit im Todeslager
Aufzeichnungen des damals (1945) achtjährigen Adam Kupferschmidt, heute lebt er in Backnang:
Umzug ins Haus von elternlosen Kindern
Wir mussten mehrmals in den 2 Jahren, welche wir in dem Elendslager verbrachten umziehen. D. h. alle Lagerbewohner einer bestimmten Gasse mussten aus ihren Unterkünften raus und sich immer wieder dem endlosen Elendszug anschließen. Dies geschah meist im Winter, so wollten die Partisanen die Todesrate beschleunigen. Ich erinnere mich noch, dass wir 1x auf eine Wiese getrieben wurden, wir mussten dort stundenlang warten. Verschiedene Leute wurden registriert, es hieß, dass sie die Leute nach ihren Familiennamen selektierten, . Wer einen deutsch klingenden Namen hatte kam auf die eine Seite und wer einen nicht Deutsch klingenden Namen hatte, kam auf die andere Seite. Nach einigen Stunden wurde diese Selektion wieder aufgegeben und alle wurden wieder ins Lager zurückgetrieben. Wir mussten uns nun eine neue Unterkunft suchen, da unsere alte Unterkunft von anderen Lagerleuten schon besetzt war. So kamen wir in die Kolutergasse (letzte Kreuzgasse Richtung Ungarn), in ein Haus, indem auch elternlose Kinder untergebracht waren. Diese ausgemergelten, verlausten und unterernährten Körper mit ihren eingefallenen Augen, vergesse ich mein Leben lang nicht mehr. Es hat sich nach der Beobachtung unserer Mutter niemand um die Kinder gekümmert. Ich begegnete den Kindern beim Toilettegang, sie bewegten sich unsicher, taumelnd, und schwach. Die hygienischen Verhältnisse in diesem Haus waren furchtbar. Es war niemand da der eine Latrine grub und die alte Latrine war randvoll, man konnte sie nicht mehr betreten. Die Leute gingen nun ins freie Gelände hinter den Schuppen. Die elternlosen Kinder setzten ihr Häuflein überall hin, wenn man ins freie Gelände wollte mußte man durch den Hof , wo ein Häuflein nach dem anderen lag. Das schlimmste was wir mit ansehen mussten war wenn ein Kind gestorben war und ein Geschwisterkind übrig blieb, das tote Kind wurde mit dem Schubkarren zum Friedhof gefahren, gefolgt von dem schon halb verhungerten Bruder oder Schwester.
Eines Tages waren dann die Kinder nicht mehr da, es hieß, dass die Kinder nach Serbien abtransportiert wurden. In diesem Haus waren wir etwa 3 Monate (ca. Febr. bis April 1946).
Danach wechselten wir in das Nachbarhaus, in welchem mehrere Filipowaer Landsleute lebten. Dies war möglich nachdem eine andere Familie aus dem Haus geflüchtet war und Platz frei wurde.
Eine unfassbare Bluttat
In diesem Haus, ist vor unserem Einzug, im kalten Winter 1945/1946 eine grausames brutales vorsätzliches Verbrechen verübt worden. Dies wurde uns, meiner Mutter und mir von verschiedenen Zeugen des Vorfalls berichtet und immer wieder wenn wir uns treffen kommen wir auf dieses grausame Verbrechen zu sprechen. Zwei dieser Zeugen sind noch am Leben und können diese Bluttat bezeugen.
In dem Haus lebten auch die deutsche Hausbesitzerin, eine Mutter mit ihrem etwa 15 jährigen Sohn und einer etwa 17 jährigen Tochter. Diese 3 Personen waren, da sie noch in ihrem Haus lebten, gut genährt und besser als die anderen Lagerleute, gekleidet. Auf dieses Mädchen wurde ein Partisan aufmerksam und versuchte an sie heran zu kommen. So war dieses Haus unter besonderer Beobachtung eines jungen Partisanen.
Es war wie schon erwähnt ein kalter Winternachmittag und es schneite an diesem Tag. Auf der Gasse gingen verschiedene Menschen und suchten Quartier. Sie wurden von einer anderen Gasse vertrieben. Die Menschen schauten auch in diesem Haus nach einem freien Plätzchen.
So kam es, dass eine Frau mit 3 kleinen Kindern und ihrem Bündel, durchnässt und vor Kälte schlotternd, in ein Zimmer drängte in dem eine Feuerstelle war und bat für sich und ihre Kinder doch Einlass zu gewähren. Die Hausbewohner lehnten dies ab, da doch kein Platz mehr vorhanden war. Die Frau ließ sich nicht vor die Tür setzen und so kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Diesen lauten Wortwechsel hat der um das Mädchen werbende und immer wieder um das Haus schleichende Partisan nun zum Anlass genommen, in die Stube zu kommen und auf seine Weise für Ruhe zu sorgen. Er trieb die verzweifelte Frau mit ihren 3 weinenden Kinder hinaus auf die verschneite und kalte Straße. Die Frau wehrte sich und wollte nochmals zurück, da griff der Partisan nach seiner Waffe und streckte die Frau brutal nieder. Blutüberströmt sackte die Frau zusammen. Die 3 weinenden Kinder schrien und weinten um ihre Mutter doch niemand traute sich hinaus. Ein Augenzeuge (er war damals 13 Jahre alt) berichtete, dass er nach etwa einer halben Stunde verstohlen und verängstigt wieder auf den Hof ging und er sah die Frau noch unter dem Schnee liegen. Es schneite weiter und bei näherem Hinsehen sah er, was das Schreckliche noch schrecklicher machte, die Frau atmete noch, der frisch gefallene Schnee bewegte sich über dem sterbenden Körper der Frau. Die Kinder waren nach Schilderung dieses Augenzeugen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf der Straße, ihre Identität und ihr Schicksal blieb unbekannt. Am nächsten Morgen war der Platz leer, nur Blutspuren im Schnee waren noch zu sehen. (Zeugen dieser Bluttat; Konrad G. geb, 1935, wohnhaft Wien und Franz R. geb, 1932, wohnhaft Ditzingen),
Quelle: Filipowaer Heimatbrief Nr.67/ 2006 /S. 94 -96
